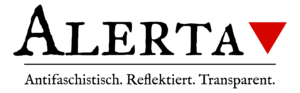Mit nur einer Stimme Mehrheit wurde Thomas Kemmerich (FDP) am 06. Februar 2020 überraschend zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt. Bei der Bekanntgabe des Ergebnisses applaudierte die AfD-Fraktion, die dem FDP-Politiker die nötigen Stimmen gaben. Ohne zu zögern nahm Kemmerich die Wahl an.
Damit wurde Kemmerich zum zweiten FDP-Ministerpräsidenten in der Geschichte der Bundesrepublik gewählt. Während der erste liberale Ministerpräsident, Reinhold Maier, Teil des linksliberalen Flügels der FDP war, der bereits in den 50er Jahren eine Regierung mit der SPD führte, steht Kemmerich für den mittlerweile fast vergessenen nationalliberalen Flügel, der seit Gründung der FDP immer wieder versuchte, die Partei nach rechts außen zu öffnen.
Braune Anfänge
Mit Ende des Zweiten Weltkrieges schossen neue und alte Parteien wie Pilze aus dem Boden. Trotz der Zäsur, die die NS-Diktatur darstellte, knüpften die Parteien an alte Traditionen aus der Weimarer Republik und dem deutschen Kaiserreich an. Schließlich war noch völlig unklar, in welche Richtung sich das neue Deutschland entwickeln würde.
In der konfusen Nachkriegsordnung der vier Besatzungszonen kam es so zu zahlreichen Gründungen liberaler Parteien, die sich, je nach Region, entweder an der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP) oder der nationalliberalen Deutschen Volkspartei (DVP) der Weimarerer Republik orientierten. Auf dem Gründungsparteitag der Freien Demokratischen Partei (FDP) im Dezember 1948 gelang schließlich das, was dem Liberalismus zuvor verwehrt blieb: Die beiden Strömungen fanden ein gemeinsames Zuhause in einer Partei.
Doch wie bei jedem Zusammenziehen entstanden auch hier bald die ersten Zwistigkeiten. Bereits auf dem Gründungsparteitag zeigten sich einige Delegierte unzufrieden mit der schwarz-rot-goldenen Dekoration. Sie favorisierten die schwarz-weiß-roten Farben des deutschen Kaiserreichs, wie sie etwa auch im Logo der DVP zu finden war.
Im Beschluss Nr. 8 der Bremer Plattform im folgenden Jahr erkannte die FDP zwar die republikanische Flagge an, jedoch hieß es auch, dass man “der schwarz-weiß-roten Fahne immer ein ehrfurchtvolles Gedenken bewahren [werde]”. Anhand dieser symbolischen Debatte zeichnete sich bereits ab, dass Teile der Partei nicht in der Bundesrepublik angekommen waren und sie sogar ablehnten.
Ein gewisser nationalistischer Hauch durchwehte jedoch die gesamte Partei. So wurde die Entnazifizierung scharf kritisiert, da sie die “Falschen” treffe und Millionen von Deutschen vom neuen Staat entfremde. Außerdem sollten ehemalige NSDAP-Mitglieder wieder in den Beamtendienst eingegliedert werden, da ein Ausschluss “mit der staatsbürgerlichen Gleichberechtigung nicht vereinbar sei” (Beschluss Nr. 11 der Bremer Plattform).
Auch sah die FDP die Rückkehr der Vertriebenen in ihre alte Heimaten als unerlässlich an, was mit der Forderung der Rückgabe der “Gebiete Deutschlands ostwärts der Oder-Neiße-Linie” verbunden war. Mit dieser Haltung standen die Freien Demokrat•innen in der Nachkriegszeit freilich nicht alleine da.
Deutschnationales Sammelbecken
Für ehemalige Nationalsozialist•innen schien die FDP in der Nachkriegszeit eine attraktive Partei zu sein. Die Forderung eines “Schlussstriches”, gepaart mit einer deutschnationalen Gesinnung in den Landesverbänden Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen, entwickelte eine Anziehungskraft für die Unbelehrbaren. Da offen rechtsextreme Parteien, wie die 1952 verbotene Sozialistische Reichspartei (SRP), trotz regionaler Erfolge, Schwierigkeiten hatten sich zu etablieren, war einer ihrer wenigen Möglichkeiten politisch Einfluss zu nehmen, etablierte Parteien zu unterlaufen.
Insbesondere in Nordrhein-Westfalen scharten sich ehemalige Nationalsozialist•innen um die FDP, die bis in höhere Führungspositionen aufstiegen. Unter dem Landesvorsitzenden Friedrich Middelhauve fielen deutschnationale Ideen auf fruchtbaren Boden. Sein Ziel war es die FDP in eine deutschnationale Sammlungsbewegung umzubauen, die die CDU rechts überholen sollte. Ohne Wissen der Bundespartei kam es bereits zu Fusionsgesprächen mit der deutschnationalen Deutsche Partei (DP) und Verbänden von ehemaligen Wehrmachts- und Waffen-SS-Mitgliedern.
Programmatisch fand dies im Deutschen Programm seinen Ausdruck. Das vermutlich von einem ehemaligen Funktionär im „Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda“ geschriebene Programm wurde auf dem Bundesparteitag 1952 in Bad Ems vorgestellt.
Inhaltlich sah es die Wiederherstellung des “Deutschen Reiches” vor, basierend auf einer „autoritäre[n] Staats- und Gesellschaftsvorstellung“ (Martens). Im Zentrum stand ein „führungsstarkes Präsidialregime innerhalb eines dezentralisierten Einheitsstaates“ (Buchna). Verbrechen der NS-Diktatur wurden mit der alliierten Besatzungspolitik gleichgesetzt.
Der baden-württembergische Ministerpräsident Reinhold Maier beispielsweise warnte damals davor, die FDP in eine Deutschnationale Volkspartei (DNVP) zu verwandeln. Sie war Koalitionspartner der NSDAP in den ersten Monaten des Jahres 1933.
Gegen das Liberale Manifest konnte sich das Deutsche Programm nicht durchsetzen. Dennoch konnten sich die Vorsitzenden der schwarz-weiß-roten Landesverbände Plätze im Bundesvorstand sichern. Middelhauve wurde gar zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Dessen rechte Hand, der Landtagsabgeordnete und frühere NS-Diplomat Ernst Achenbach, wurde zum gleichen Zeitpunkt bereits in der schwedischen Zeitung Dagens Nyheter als “Spiritus rector” einer neuen “Harzburger Front” betitelt.
Naumann-Affäre
Achenbach war das Bindeglied zwischen ehemaligen hochrangigen NSDAP-Mitgliedern und dem FDP-Landesverband Nordrhein-Westfalen. Bereits 1950 sprach er mit Goebbels persönlichen Referenten Dr. Werner Naumann über die Möglichkeit die FDP mit Nationalsozialisten zu unterwandern. “Mit nur 200 Mitgliedern können wir den ganzen Landesvorstand erben. Mich will er als Generalsekretär o. ä. engagieren!!”, notierte Naumann in sein Tagebuch.
Der britische Geheimdienst war über die konspirativen Treffen und die Pläne des “Naumann-Kreises” informiert. Wenige Monate nach dem FDP-Bundesparteitag in Bad Ems verhafteten britische Sicherheitsoffiziere in verschiedenen westdeutschen Städten Mitglieder des “Naumann-Kreises”. Der Gruppe wurde vorgeworfen, die “Wiederergreifung der Macht in Westdeutschland” anzustreben. Am 01. August 1953 wurde Naumann aus der Untersuchungshaft entlassen und die Verfahren gegen die Beschuldigten eingestellt.
Achenbach hat die Affäre jedoch kaum geschadet: Auf Wunsch Middelhauves kandiderte er 1953 erstmals für den Bundestag in Bonn und wurde vier Jahre später sogar gewählt. Laut dem Historiker Norbert Frei bedeutete die Naumann-Affäre das “Aus für alle Hoffnungen auf eine große Sammlungspartei rechts der Union.“ Aus dem Sumpf der deutschnationalen und völkischen Parteien entstand schließlich 1964 die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD). Die “Neue Rechte” hingegen versuchte die Gunst Franz Josef Strauß’ (CSU) zu erwerben.
Geistig-moralische Wende
Nach den nationalliberalen Episoden der Anfangsjahren wechselte die FDP Ende der 1960er Jahre die Spur. “Opas FDP ist tot” war der Slogan des Bundesparteitags 1968. Die Abkehr vom rechten Nationalliberalismus hin zu einer modernen, progressiven Partei wurde vor allem von jungen Mitgliedern vorangetrieben. Die Liberalisierung der Liberalen war mit der Koalition mit den Sozialdemokrat•innen 1969 vorerst abgeschlossen.
Erst als die FDP die sozial-liberale Koalition 1982 platzen ließ und in einem Misstrauensvotum für Helmut Kohl (CDU) stimmte, kam die Partei erneut in eine tiefe Krise. Die linksliberalen “Deutschen Jungdemokraten” trennten sich von der FDP als “parlamentarischer Ansprechpartner”. Auf dem “Parteitag der Tränen” zogen enttäuschte linksliberale Delegierte ihre Konsequenzen: Einige wechselten zur SPD, andere versuchten eine neue Parteigründung oder zogen sich ganz aus der Politik zurück.
Die “geistig-moralische Wende”, wie von Helmut Kohl versprochen, schien sich auch in der FDP breit zu machen. Schließlich betonte der Bundeskanzler rückblickend, dass es bei der Wende auch darum ging, die “bürgerliche Mitte” in den Vordergrund zu stellen und “keine Experimente mehr im linken Spektrum” zuzulassen.
Trotz der Kontinuität der Außenpolitik der sozial-liberalen unter Hans-Dietrich Genscher, schien die liberale Partei auch für rechtsradikale Kräfte wieder interessant zu werden. Ende der 80er Jahre wechselten etwa Franz Handlos und Ekkehard Voigt von den “Republikanern”, die sie mitgegründet hatten, zur FDP. In der Wendezeit fusionierte die FDP unter anderem mit der DDR-Blockpartei National-Demokratische Partei Deutschlands (NPDP), die “ursprünglich als Auffangbecken für kleine ehemalige Nazis und Berufssoldaten gedacht” war (Dittberner).
Gleichzeitig bedeuteten die 90er Jahre eine erneute Krise für die Freien Demokrat•innen. Zwischen 1990 und 1998 verlor die Partei rund 5 Prozent an Zustimmung bei den Bundestagswahlen und näherte sich gefährlich der 5-Prozent-Hürde. Ende des Jahrzehnts war sie nur noch in vier Länderparlamenten vertreten. Versuche einer neonationalen Gruppe den Berliner Landesverband zu “haiderisieren” (Dittberner) scheiterten.
“Projekt 18”
Durch Erfolge bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2000 konnten die Liberalen wieder Selbstbewusstsein tanken. Dabei erwischten sie wohl etwas zu viel: Mit dem von Möllemann entwickelten “Projekt 18” sollte die FDP zur liberalen Volkspartei werden, die auf Augenhöhe mit Union und SPD mithalten sollte. Um dieses Vorhaben zu unterstreichen, wählten sie mit Guido Westerwelle sogar erstmals einen liberalen Kanzlerkandidaten.
Die FDP entwickelte sich zur “Spaßpartei” mit quietschgelben Guidomobil und einem “Big Brother” Auftritt. “[D]as Marketing rückte an die Stelle der politischen Debatte.” beschrieb der Spiegel das “Projekt Größenwahn.” Ausgerechnet der Vater des “Projekt 18” sollte jedoch grob dazwischen grätschen.
Als der Grünen-Politiker Jamal Karsli die israelische Politik mit der der Nazis verglich, bekam dieser Unterstützung von Möllemann. Als Mitglied des Landtags wechselte Karsli zur Fraktion der FDP, trat jedoch, aufgrund massiver Kritik, wieder aus. Insbesondere der Zentralrat der Juden und dessen Vizepräsident Michel Friedman kritisierten Möllemann für seine Haltung in der Angelegenheit.
Der FDP-Politiker bezeichnete daraufhin Friedman als “übergeschnappt” und warnte ihn davor, dass er mit “unverschämten Unterstellungen […] Unmut gegen die Zielgruppe, die er zu vertreten vorgibt” schüre. Eine Entschuldigung bei Friedman lehnte Möllemann stets ab.
In einem kurz vor der Bundestagswahl 2002 erschienenen Flugblatt in Nordrhein-Westfalen kritisierte Möllemann erneut die Politik Israels. Neben der Frage der Finanzierung, stellte sich auch die Frage, ob Möllemann bewusst versuchte Stimmen aus dem rechten Rand einzufangen. Kritiker•innen sahen bereits bei der Verwendung der Zahl 18 einen rechtsextremen Code.
Die Antisemitismus-Debatte fügten der FDP massiven Schaden zu. Zwar konnte sie bei der Bundestagswahl 1,2 Prozent Stimmen hinzugewinnen, doch mit 7,4 Prozent blieb man weit von dem angepeilten Ziel des „Projekts 18“ entfernt.
Nichts gelernt
Die Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidenten rief der FDP wieder ins Gedächtnis, dass sich eine Annäherung an rechtsaußen nicht lohnt: Umfragen unmittelbar nach seiner Wahl zeigten die Liberalen unter der 5-Prozent-Hürde. Damit folgt die FDP dem Trend ihrer eigenen Geschichte: Bereits nach der Naumann-Affäre 1953 verzeichnete die FDP Verluste von 2,4 Prozent, dreißig Jahre später, beim Wechsel zur Union, ganze 3,6 Prozent. Diesen Warnschüssen sollte die FDP Gehör schenken: Rechtsaußen gab es für sie nichts und wird es auch zukünftig nichts für sie zu holen geben.
Literatur
Assheuer, Thomas und Hans Sarkowicz. Rechtsradikale in Deutschland: die alte und die neue Rechte. Aktualisierte Ausgabe. Beck’sche Reihe 428. München: Beck, 1994.
Buchna, Kristian. „‚Liberale‘ Vergangenheitspolitik: Die FDP und ihr Umgang mit dem Nationalsozialismus“. HEUSS-FORUM, 2017.
Dittberner, Jürgen. Die FDP: Geschichte, Personen, Organisation, Perspektiven. Eine Einführung. Überarbeitete und Aktualisierte Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010.
Frei, Norbert. „Deutsches Programm“. ZEIT ONLINE
Martens, Rita. „Deutsches Programm der FDP“. In Lexikon der »Vergangenheitsbewältigung in Deutschland: Debatten- und Diskursgeschichte des Nationalsozialismus nach 1945«, herausgegeben von Torben Fischer und Matthias N. Lorenz, 87f. Bielefeld: transcript Verlag, 2015.
Michel, Marco. Die Bundestagswahlkämpfe der FDP 1949-2002. 1. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005.
Strobel, Robert. „Das doppelte Gesicht der FDP“. Die Zeit, 27. November 1952.
„Schwarz-weiß-rot-gold“. Der Spiegel, 25. November 1952.